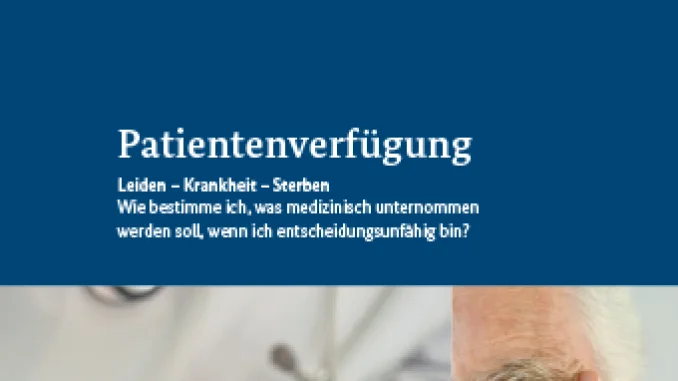Hilfreiche Informationen und Downloads
Newsfilter
Aktuell
Weitere Nachrichten

Vorsorgedokumente
Über die folgenden Links kommen Sie direkt zu unseren Informationen und Vorlagen zu Vorsorgevollmachten Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen:
Vollmacht Betreuungsverfügung Patientenverfügung
Mehr zum Thema Vorsorge allgemein, sowie Kontaktmöglichkeiten erhalten sie unter “Vorsorge”.
Bleiben Sie gesund …
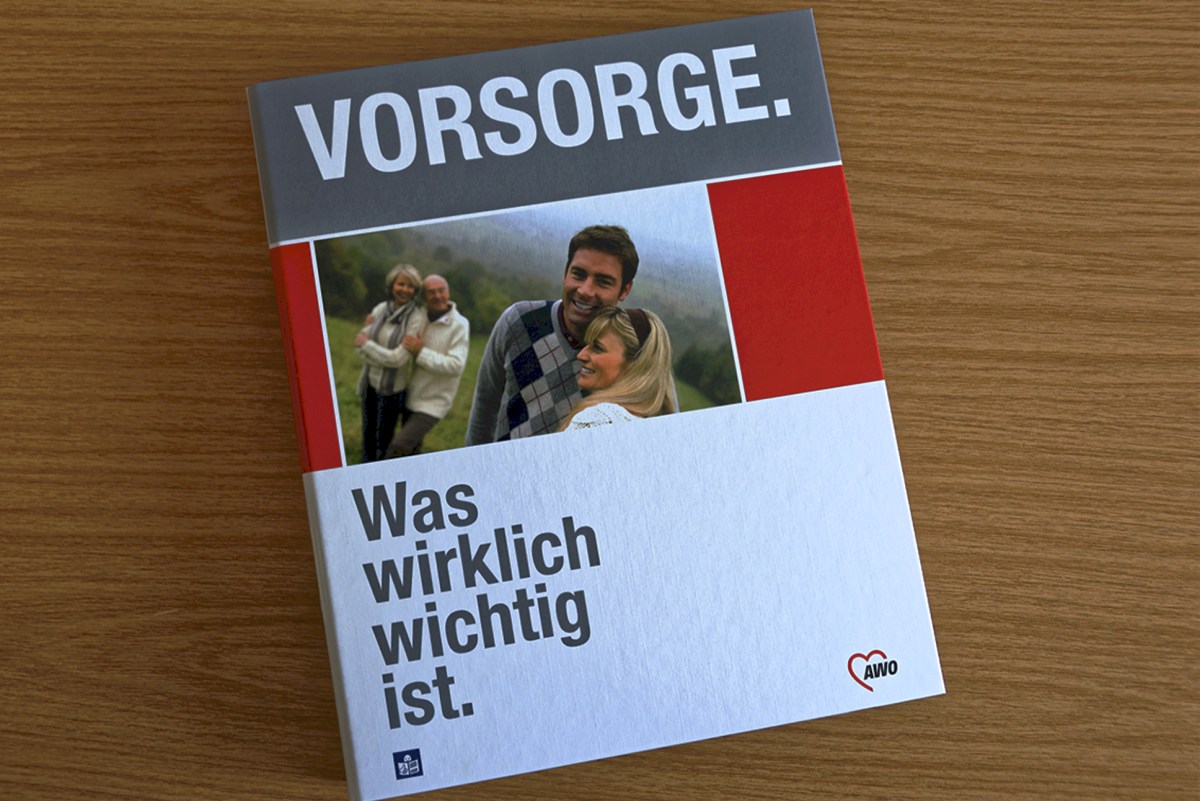
Downloads
Dieser Bereich entsteht zurzeit noch. Zukünftig werden Sie hier hilfreiche Informationen und Downloads zu Thema der ehrenamtlichen gesetzlichen Betreuung finden:
- Antrag Aufwandspauschale § 1835a BGB – Mittellose
- Antrag
- Aufwandspauschale § 1835a BGB – Vermögende
- Checkliste: Beginn einer Betreuung
- Was ist bei einer Heimaufnahme zu beachten?
- Wohnung kündigen?
- Wir erstellt man einen Anfangs-, Jahresbericht für das Betreuungsgericht?
- Wie erstellt man ein Vermögensverzeichnis für das Betreuungsgericht?
- Musterbriefe für den persönlichen Gebrauch
Interessantes
Was macht ein*e rechtliche*r Betreuer*in?
Was macht eigentlich ein gesetzlicher Betreuer? Ich selber arbeite mittlerweile an die 20 Jahre im sozialen Feld. 12 Jahre davon im vollstationären sozialpsychiatrischen Kontext und darin 2 Jahre als Bereichsleitung. Wenn „wir“ Mitarbeiter mit einem Menschen überhaupt nicht mehr weiter wussten, richteten wir uns an den gesetzlichen Betreuer – und dieser meldete sich oft nicht zurück! Oder bestimmte einfach nicht, wie der Klient sich ändern musste, damit wir wieder arbeitsfähig wurden.
Nun arbeite ich selber seit Ende 2016 als gesetzlicher Betreuer und meine Sicht auf diesen Beruf hat sich immens verändert. Klar! Zeit, meine Sicht darauf zu relativieren.
Was macht eigentlich ein gesetzlicher Betreuer?
Ein gesetzlicher Betreuer kann dann erforderlich werden, wenn ein Mensch seine persönlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Oft übernehmen diese Tätigkeiten nahe Angehörige und damit diese auch handlungsfähig sind, bedarf es entweder einer sogenannten Vorsorgevollmacht, oder wenn letztere nicht vorhanden, die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung.
Hintergrund ist hierbei, dass irgend ein Anderer nicht einfach für Sie „Rechtsgeschäfte“ abwickeln darf. Rechtlich dürfen nur Sie selber mit der Krankenkasse, der Rentenversicherung, dem Sozialamt, dem Arzt oder der Ärztin, der Bank, dem Jobcenter, der allseits beliebten GEZ (die heißt wohl jetzt anders) und vielen Weiteren Informationen austauschen, oder gar Anträge stellen.
Oft ist uns gar nicht bewusst, was wir für uns selber alles an bürokratischen Dingen tun und erledigen. Denken Sie einmal an Ihre ganz eigene Situation. Sie bekommen wahrscheinlich regelmäßig Rechnungen jedweder Art. Für viele Ihrer Zahlungsverpflichtungen, vor allem für die immer wieder kehrenden, haben Sie möglicherweise schon einen Dauerauftrag eingerichtet, oder einem SEPA Lastschriftmandat zugestimmt.
Sie bekommen auch regelmäßig Post von Ihrem Rentenversicherungsträger, welcher Sie über den aktuellen Stand der zu erwartenden Rente informiert.
Waren Sie, warum auch immer, im Krankenhaus, besprechen Sie Ihre gesundheitliche Situation mit dem Arzt und dem Pflegepersonal. Dabei darf der Arzt offiziell nur mit Ihnen persönlich sprechen. Er oder sie darf anderen Menschen ohne Ihre Zustimmung keinerlei Auskünfte geben. Möglicherweise müssen Sie mit Ihrer Unterschrift der Anästhesie und der Blinddarmoperation zustimmen.
Benötigen Sie möglicherweise irgendwann einen Pflegedienst zu Hause, müssen Sie bei der Pflegekasse erst einen Pflegegrad anerkannt haben, da sonst keine Pflegegelder bezahlt werden. Die Überprüfung auf einen solchen Pflegegrad muss beantragt werden, damit der medizinische Dienst der Krankenkassen zu Ihnen kommen und mit Ihnen sprechen darf.
Ein letztes Beispiel: Sie haben vielleicht einmal versäumt eine Rechnung zu bezahlen, oder waren der Meinung, dass diese Rechnung nicht Rechtens ist. Der Gläubiger übergibt seine Forderung an ein Inkassounternehmen. Diese Inkassounternehmen erlebe ich selber als sehr lästig, aber Schriftverkehr muss hier kontinuierlich beantwortet werden, damit diese Angelegenheit nicht zu einem Gerichtsvollzieher geht.
Alle diese Dinge dürfen Sie nur selber für sich tun. Können Sie das nicht selber machen, aus welchen Gründern auch immer, darf dies so ohne Weiteres nicht einfach ein anderer für Sie tun. Nicht mal Ihr Ehepartner, oder Ihre Eltern wären automatisch bevollmächtigt, in Ihrem Namem zu agieren.
Diese Rechtsgeschäfte müssen aber von jemanden übernommen werden, damit Sie keinen Schaden erleiden: Sie bekommen auf einmal keine Rente, keine Sozialleistungen mehr überwiesen, weil ein bestimmter Antrag nicht gestellt wurde! Auf einmal steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür und will den Familienschmuck mitnehmen! Der Pflegedienst kommt auf einmal nicht mehr, weil kein Pflegegeld gezahlt wird! Ein Arzt führt eine Operation an Ihnen durch, die sie so gar nicht gewollt hätten!
Ein Ehepartner, die eigenen Eltern, oder die eigenen Kinder sind per Gesetz nicht automatisch bevollmächtigt, für Sie vertretend Entscheidungen zu treffen, oder solchen Schriftverkehr zu führen.
Jetzt muss also jemand her, der diese Rechtsgeschäfte für Sie und in Ihrem Sinne zu bearbeiten. Hier gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Sie können bevor solch ein Verhinderungsfall eintritt eine sogenannte Vorsorgevollmacht ausstellen. D.h. Sie benennen eine bestimmte Person, oder mehrere, die vertretend für Sie handeln dürfen, und bestätigen dies schriftlich. Oder es wird vom Gericht ein*e Gesetzlicher Betreuer*in bestellt!
In welchem gesetzlichen Kontext bewegt sich ein rechtlicher Betreuer?
BGB: § 1901 - Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers
(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen.
(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.
(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. 3Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft.
(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Wird die Betreuung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in geeigneten Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn der Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen darzustellen.
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung ermöglichen, so hat er dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die eine Einschränkung des Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Bestellung eines weiteren Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfordern.
Hier wird meines Erachtens schon ein häufiges Missverständnis deutlich, eben dass ein gesetzlicher Betreuer nicht so ohne weiteres über einen Betreuten bestimmen darf. Aus den obigen Gesetzestexten ergibt sich sogar eine Rangfolge, die ein Betreuer in der Ausübung seiner Tätigkeit einzuhalten hat:
An erster Stelle stehen die Wünsche (der Wille) der Betreuten und danach erst das Wohl (z.B. die Gesundheit). Mögliche Entscheidungen gegen den Willen der Betreuten können folglich erst dann stattfinden, wenn der Wunsch und Wille des Klienten ein großes Risiko für dessen Wohl darstellt. Und auch dann darf ein Betreuer vieles nicht einfach bestimmen, sondern muss möglicherweise entsprechende Anträge beim Betreuungsgericht stellen. Nur Richter dürfen bestimmte Entscheidungen, vor allem solche, die sich gegen den freien Willen eines Menschen richten, treffen. Beispiele mögen hier vor allem Krankenhausbehandlungen gegen den Willen einer Person sein, weil diese sich stark eigen- oder fremdgefährdend verhält.
Betreuung: Einschnitt in die Freiheit?
Im Prinzip ist die gesetzliche Betreuung keine Tätigkeit des Bestimmens über andere Menschen, sondern eher mit einer Universalvollmacht zu vergleichen. Wir Betreuer sind vertretungsberechtigt für unsere Klienten, im Rahmen der Aufgabenbereiche, die das Gericht uns zugesprochen hat. Das ist schon auch eine Form von Eingriff in die Freiheit eines Menschen. Angelegenheiten, die jeder Mensch normalerweise nur selbst für sich erledigen darf, dürfen wir in Vertretung für ihn machen. Beispiele fanden Sie weiter oben unter „Was macht eigentlich ein gesetzlicher Betreuer?“.
Wie kommt es zu einer gesetzlichen Betreuung
Rechtliche Betreuung ist eine sogenannte nachrangige Hilfe. D.h. erst wenn andere Hilfemöglichkeiten ausgeschöpft sind und oder nicht mehr ausreichen, kann über eine gesetzliche Betreuung nachgedacht werden. Der Bedarf an dieser Hilfe muss zunächst bekannt gemacht werden. Man kann für sich selbst zum zuständigen Amtsgericht gehen, oder zur zuständigen Betreuungsbehörde. Letztere ist oft Teil der lokalen Kreis- oder Stadtverwaltung. Die Kollegen der Betreuungsbehörde verschaffen sich, möglicherweise durch einen Hausbesuch, einen persönlichen Eindruck in die Verhältnisse des potentiell zu Betreuenden und formulieren daraufhin einen Sozialbericht / Stellungnahme an das Betreuungsgericht. Diese Stellungnahme enthält dann auch eine Empfehlung, ob eine Betreuung sinnvoll, oder notwendig erscheint. Der Richter benötigt nun eine fachärztliche Stellungnahme, aus der der gesundheitliche Grund für die mögliche Betreuung hervorgeht, eine Diagnose z.B.. Diese Stellungnahme muss auch Informationen darüber enthalten, ob dem Klienten durch eine gesetzliche Betreuung Nachteile entstehen könnten, ob dieser mit einer gesetzlichen Betreuung einverstanden ist und für welche Aufgabenfelder diese Betreuung eingerichtet werden sollte. Abschließend muss der Richter nun noch eine persönliche Anhörung durchführen und kann danach seine Entscheidung treffen. Grundbedingung ist immer, dass der Klient grundsätzlich mit der Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung einverstanden ist. Ist dieser nicht einverstanden, darf auch keine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden, es sei denn, es bestünden ohne eine solche Betreuung erhebliche Gefahren für den Klienten: Verschuldung, Einkommensverlust, Wohnungsverlust, oder eine extreme Gesundheitsgefährdung.
Wird die Betreuung dann vom Gericht beschlossen, darf diese nur die absolut notwendigsten Aufgabenbereiche beinhalten, damit der Betreute immer noch so viel wie möglich selber regeln kann / darf / soll. Zur Verfügung stehen folgende Aufgabenbereiche, manchmal auch Wirkungskreise genannt: Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestimmung, Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten, Vertretung des Betroffenen in gerichtlichen Verfahren, Vertretung gegenüber Behörden, Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betroffenen und über die Entgegennahme und das Öffnen und Anhalten seiner Post, Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten.
Darüber hinaus kann ein Richter zusätzlich zu diesen Aufgaben noch einen sogenannten Einwilligungsvorbehalt bestimmten. Ein Mensch ist laut Gesetz Einwilligungsfähig, solange er die Folgen seiner Entscheidungen abschätzen kann. Hat ein rechtlicher Betreuer einen Einwilligungsvorbehalt, z.B. in der Vermögenssorge, bedürfen sämtliche davon betroffenen Rechtsgeschäfte der expliziten Einwilligung durch den Betreuer, ansonsten sind diese rechtlich nicht zustande gekommen, auch wenn der Betreute einen Vertrag unterschrieben hat. Der Gesetzgeber spricht hier davon, dass ein vom Klienten unterschriebener Vertrag solange „schwebend unwirksam“ ist, bis der gesetzliche Betreuer diesen bestätigt hat.
Eine gesetzliche Betreuung kommt immer dann in Betracht, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen seine rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selber regeln kann. Ursache hierfür können altersbedingte Einschränkungen, wie etwas eine fortgeschrittene Demenz, eine schwerwiegende psychische Erkrankung und auch eine körperliche oder geistige Behinderung sein.
Welche Arten von gesetzlicher Betreuung gibt es?
Das Gericht prüft bei Einrichtung einer solchen Betreuung zuerst, ob es im sozialen Umfeld eines Klienten jemanden gibt, der diese Betreuung übernehmen kann und will. Dies sind oft Verwandte: Die Tochter oder der Sohn, oder auch Mutter oder Vater. Grundsätzlich können dies auch dem Klienten sehr nahestehende Personen sein, wie etwa Freunde. Solche gesetzlichen Betreuungen nennt man „ehrenamtliche Betreuungen“. Die zu leistenden Tätigkeiten werden vom Amtsgericht nicht vergütet. Ein ehrenamtlicher Betreuer kann lediglich eine jährliche Aufwandsentschädigung von ca. € 400,- geltend machen.
Steht kein ehrenamtlicher Betreuer zur Verfügung, muss ein Berufsbetreuer bestellt werden. Hier gibt es die selbständigen und die Vereinsbetreuer. Selbständige Berufsbetreuer können alleine arbeiten, oder sich mit anderen Betreuern zusammen schließen. Sie rechnen ihre Vergütungen direkt mit dem Amtsgericht ab und sind zu jährlichen Rechnungslegungen, Berichten und Stellungnahmen verpflichtet.
Und Last but not Least die Vereinsbetreuer! Diese sind „normale“ Angestellte, meist in einem der großen Wohlfahrtsverbände. Ich selber bin angestellt beim Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel. Betreuungsvereine haben meist den Vorteil, dass über die eigentlichen gesetzlichen Betreuer hinaus noch eine zusätzlich Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Räume, Telekommunikation, Abrechnung, Verwaltung. Außerdem sind wir in meinem Fall mit 4 gesetzlichen Betreuern in einem Bürokomplex und können uns gegenseitig beraten, supervidieren, unterstützen und vor allem vertreten. Damit sind wir zumindest statistisch mit einer besseren Erreichbarkeit ausgestattet, als „Einzelkämpfer“.
Kontrolle der gesetzlichen Betreuer
Da gesetzliche Betreuer über ihre Vertretungsrechte relativ große „Macht“ besitzen, muss es hier auch ein besonderes Kontrollsystem geben. Die Mehrheit meiner Klienten z.B. sind eher Empfänger von Grundsicherungs- oder Jobcenterleistungen. Aber ich betreue auch eine alte Dame in einer Alteneinrichtung, welche über ein Gesamtvermögen von ca. 1 Millionen Euro verfügt. Da diese Dame eine fortgeschrittene Demenz hat, kümmere ich mich selbstverständlich um alles. Clevere und pfiffige Menschen könnten hier sicherlich Wege finden, sich persönlich an diesem Vermögen zu bereichern. Damit dies möglichst ausgeschlossen ist, ist ein Kontrollsystem installiert:
Die Rechtspfleger*innen im Betreuungsgericht stellen dieses Kontrollorgan dar. Hier werden min. jährliche Berichte angefordert, in denen auch Rechenschaft über das Vermögen geleistet werden muss. Zusätzlich werden regelmäßig sogenannte Rechnungslegungen eingefordert, bei denen prinzipiell jeder „Cent“ des Vermögens belegt werden muss. Oft werden Begründungen eingefordert, warum wie mit dem Vermögen umgegangen worden ist. Vorhandene Gelder der Klienten müssen, wenn möglich, „mündelsicher“ angelegt sein. Dies ist jedoch bei der derzeitigen Zinssituation kaum möglich. Risikogeschäfte sind grundsätzlich gerichtlich genehmigungspflichtig; z.B. Geld in Aktien anzulegen oder ähnliches. Geldgeschäfte mit erheblichem Wert, wie z.B. Immobilienverkäufe sind ebenso gerichtlich zu genehmigen. In diesen Genehmigungsprozessen wird dann zusätzlich eine sogenannte Verfahrenspflege hinzu genommen. Also ein neutraler, von „Außen“ kommender Experte (oft Anwält*innen), die einen kompletten Sachverhalt nochmals unter den verschiedensten Gesichtspunkten prüft, bevor die gerichtliche Entscheidung / Erlaubnis gegeben wird.
Kann es dennoch zu Missbrauch, oder fahrlässigen Verlusten kommen?
Ja! Selbstverständlich ist das möglich. Hier sind allenthalben Menschen beteiligt. Menschen machen Fehler. Wo kann dies schon 100% ausgeschlossen werden. Selbstverständlich gibt es auch Menschen, die Situationen ausnutzen, um sich persönlich zu bereichern. Wahrscheinlich wird es immer Möglichkeiten geben, das Kontrollsystem zu überlisten. Dies gibt es wohl in jeden Bereich und niemand kann sich gänzlich davon frei sprechen: Kindesmissbrauch, Polizeiskandale, Steuerbetrug – dies alles passiert immer wieder, obwohl es Kontrollsysteme gibt und Fehler in Systemen lassen sich nie vollständig ausschließen.
Allen Berufsbetreuern ist empfohlen sich zusätzlich zu versichern, damit man bei Fehlern nicht mit dem Privatvermögen haftet. Wir Vereinsbetreuer sind deshalb auch über unseren Arbeitgeber versichert. Fehler sollten natürlich vermieden werden, aber können ebenso wenig ausgeschlossen werden. Bei fahrlässigen Fehlern wird dann auch keine Versicherung bezahlen.
Besondere Aufgabenbereiche
Vermögenssorge: Dieser Aufgabenkreis beinhaltet die Kontrolle und Verwaltung des Vermögens der betreuten Personen, sowie auch die Geltendmachung von gesetzlichen Ansprüchen. Es wird dafür gesorgt, dass laufenden Verpflichtungen nachgekommen wird, dass Schulden möglichst reguliert werden und dass genug Geld für die allgemeine Lebenshaltung vorhanden ist. Dabei dürfen betreute Personen grundsätzlich weiterhin über ihr Vermögen selber verfügen. Oft werde ich von Banken angerufen, wenn einer meiner Klienten dort Geld abholen möchte. Dies ist oft hilfreich, jedoch rechtlich überflüssig und sogar unzulässig. Schließlich ist es nicht mein Eigentum und der Klient soll damit machen dürfen, was auch immer er möchte. Meine Arbeit beginnt erst, wenn der Betreute Geld abhebt und ausgibt, bevor wichtige Zahlungsverpflichtungen eingehalten werden können. Bleibt nicht genug Geld für die Zahlung der Miete auf dem Konto, kann dadurch Verschuldung und Wohnungsverlust drohen. Dies versuche ich selbstverständlich zu verhindern und das erste Mittel der Wahl hierzu, ist eine persönliche Absprache / Vereinbarung mit meinem Klienten.
Die Gesundheitsfürsorge beinhaltet auf der einen Seite relativ einfache Tätigkeiten: vertretungsweise Unterschriften für Einverständniserklärungen z.B. vor Operationen. Schriftverkehr mit den Kranken- und Pflegekassen, Begleitung zu Ärzten können, aber müssen nicht notwendig sein. Es kann aber auch passieren, dass ein Betreuter im Sterben liegt. Dann wird der gesetzliche Betreuer möglicherweise gefragt, ob nicht eine medikamentöse Versorgung, oder die Zufuhr von Flüssigkeiten reduziert werden sollte, in dem Wissen, dass der Betreute dann schneller versterben könnte. Bei solchen Fragestellungen sollten man seine Betreuten gut kennen. Oft raten wir unseren Klienten, eine Patientenverfügung zu erstellen, die solche Fälle im Vorhinein regelt. Bei bestimmten Eingriffen, immer in Situationen, in denen sich unsere Betreuten selber nicht äußern können, reicht es oft aus, wenn behandelnder Arzt und Betreuer einer Meinung sind.
Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten Willen des Betreuten entspricht (https://dejure.org/gesetze/BGB/1904.html).
Sind diese beiden nicht einer Meinung, oder handelt es sich um einen medizinischen Eingriff mit größeren Auswirkungen und oder Einschränkungen, muss stets das Betreuungsgericht hin zu gezogen werden.
Was das Aufenthaltsbestimmungsrecht angeht glauben viele Menschen fälschlicherweise, dass der Betreuer bestimmen darf, wo jemand wohnt, ob jemand umziehen muss, ob jemand in eine Alteneinrichtung muss, oder ob jemand ggfls. gegen seinen Willen in ein Krankenhaus eingewiesen wird. Das ist jedoch nicht ganz so einfach, wie es dieser Begriff impliziert. Immer wenn jemand überhaupt nicht in der Lage ist, den eigenen Willen zu äußern, kann der Betreuer zum Beispiel den Aufenthalt stellvertretend bestimmen. Ein alleinstehender, sehr dementer Mensch, der nicht mehr alleine zu Hause leben kann, da sonst erhebliche Gefahren zu erwarten sind: Hier kann der Betreuer über das Aufenthaltbestimmungsrecht einem Umzug in eine Pflegeeinrichtung zustimmen. Oder ein psychisch kranker Mensch, der sich wegen einer akuten Psychose im Krankenhaus befindet: Wenn dieser sich selber entlassen möchte, aus ärztlicher Sicht aber dadurch erhebliche Gefahren für Leib und Seele zu erwarten sind, kann der gesetzliche Betreuer, wenn er das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, bestimmen, dass der Betreute im Krankenhaus verbleiben muss, bis diese ganze Angelegenheit durch einen Richter überprüft wurde.
Ist der Betreuer der Meinung, dass ein Betreuter z.B. in ein psychiatrischen Krankenhaus eingewiesen werden sollte, da dieser sonst Schaden gegen sich selber oder andere verursachen könnte, muss er einen entsprechenden Antrag auf eine stationäre Behandlung, möglicherweise sogar gegen den Willen des Betroffenen, beim lokalen Amtsgericht stellen. Entscheidungen, die gegen den Willen der Betreuten gerichtet sind können nur durch einen Richter entschieden werden; und ein Richter wird auch immer zusätzlich einen neutralen fachärztlichen Gutachter einschalten. Ganz im Gegenteil könnte ein gesetzlicher Betreuer sogar haftbar für Schaden gemacht werden, weil er in einer solchen Situation nicht einen entsprechenden Antrag beim Gericht eingereicht hat. Hier überschneiden sich das Aufenthaltsbestimmungsrecht und die Gesundheitssorge.
Abschluss:
Der Beruf des gesetzlichen Betreuers ist nicht nur sehr verantwortlich, sondern auch sehr vielseitig. Da wir mit allen erdenklichen Lebensbereichen zu tun haben, müssen wir über diese auch immer sehr gut informiert sein. Qua Gesetz sind wir verpflichtet, stets das Beste für unsere Betreuten zu erreichen. Dies macht es notwendig, immer auf dem neuesten Stand der sozialrechtlichen Angelegenheiten zu sein. Wir prüfen Grundsicherungs- und Jobcenterbescheide auf deren Richtigkeit und streiten uns mit den Ämtern, wenn wir glauben, etwas sei nicht in Ordnung. In sehr komplexen Situationen schalten wir Anwälte, Steuerberater, Schuldnerberatungen und Fachärzte ein, um unseren Verpflichtungen der Klienten und dem Amtsgericht gegenüber nachzukommen.
Wir sind aber auch oft Ansprechpartner für die persönlichen Probleme unserer Betreuten und für die Kollegen des erweiterten Hilfesystems: Betreutes Wohnen, Wohnheime, Alteneinrichtungen und Pflegedienste.
Was uns gesetzlichen Betreuern eindeutig fehlt, ist eine politische Lobby. Statistisch stehen ca 1% der deutschen Bevölkerung unter gesetzlicher Betreuung und darin sind auch schon die ehrenamtlichen Betreuer enthalten. Keine gute Basis dafür, eine interessante Wählerschaft für Politiker zu sein.
In den Betreuungsvereinen muss ein vollzeitbeschäftigter gesetzlicher Betreuer ca. 50 Menschen betreuen, damit dessen Stelle auch refinanziert ist. Ich selber behaupte, dass ca. 30 Betreuungen einer Zahl entsprechen würde, in denen man sich wesentlich persönlicher um die Menschen kümmern könnte. Sehr vieles was wir tun, tun wir im Hintergrund und viele unserer Betreuten bekommen das oft gar nicht mit. Erst wenn wir unsere Arbeit nicht richtig machen, fällt auf, was wir tun (oder lassen). Deshalb heißt es auch oft: „Meinen Betreuer sehe ich kaum!“
Die Pauschalen der Justiz sind so niedrig, dass Betreuungsvereine oft von den Kommunen „aufgestockt“ werden müssen, damit Sozialarbeiter oder Anwälte nach Tarif bezahlt werden können. Sie sind jedoch im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten im sozialen Feld direkt privat haftbar für Fehler in der Arbeit, da wir stets persönlich vom Gericht benannt werden.
Zum Schluss:
Die Betreuungsvereine bieten über die gesetzliche Betreuung hinaus noch weitere Angebote an. Wir beraten Sie kostenlos zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. So können Sie zum Beispiel direkt bei mir einen persönlichen Termin vereinbaren und ich berate Sie zu diesen Themen nicht nur, sondern wir können auch Ihre individuelle Vorsorgevollmacht und oder Patientenverfügung erstellen. Gerne können Sie mich auch zu einem Vortrag über diese Themen einladen.
Darüber hinaus stehe ich auch für ehrenamtliche gesetzliche Betreuer zur Verfügung. Ich kann Sie mit wichtigen Informationen zu Ihren Aufgaben beraten und Sie auch im Schriftverkehr mit Ämtern und Behörden unterstützen. Ich erkläre Ihnen wie Sie Jahresberichte und Rechnungslegungen erstellen und was Sie im Umgang mit Ihren Aufgabenbereichen beachten müssen. In Planung sind bereits Vorträge und Fortbildungsveranstaltungen, die in 2020 stattfinden sollen.
Das komplette Betreuungsrecht
Rechtliche Betreuung
Untertitel 1
Betreuerbestellung
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 1814 Voraussetzungen
(1) Kann ein Volljähriger seine Angelegenheiten ganz oder teilweise rechtlich nicht besorgen und beruht dies auf einer Krankheit oder Behinderung, so bestellt das Betreuungsgericht für ihn einen rechtlichen Betreuer (Betreuer).
(2) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.
(3) Ein Betreuer darf nur bestellt werden, wenn dies erforderlich ist. Die Bestellung eines Betreuers ist insbesondere nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen 1. durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1816 Absatz 6 bezeichneten Personen gehört, gleichermaßen besorgt werden können oder 2. durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, erledigt werden können, insbesondere durch solche Unterstützung, die auf sozialen Rechten oder anderen Vorschriften beruht.
(4) Die Bestellung eines Betreuers erfolgt auf Antrag des Volljährigen oder von Amts wegen. Soweit der Volljährige seine Angelegenheiten lediglich aufgrund einer körperlichen Krankheit oder Behinderung nicht besorgen kann, darf ein Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann.
(5) Ein Betreuer kann auch für einen Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr vollendet hat, bestellt werden, wenn anzunehmen ist, dass die Bestellung eines Betreuers bei Eintritt der Volljährigkeit erforderlich sein wird. Die Bestellung des Betreuers wird erst mit dem Eintritt der Volljährigkeit wirksam.
§ 1815 Umfang der Betreuung
(1) Der Aufgabenkreis eines Betreuers besteht aus einem oder mehreren Aufgabenbereichen. Diese sind vom Betreuungsgericht im Einzelnen anzuordnen. Ein Aufgabenbereich darf nur angeordnet werden, wenn und soweit dessen rechtliche Wahrnehmung durch einen Betreuer erforderlich ist.
(2) Folgende Entscheidungen darf der Betreuer nur treffen, wenn sie als Aufgabenbereich vom Betreuungsgericht ausdrücklich angeordnet worden sind: 1. eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung des Betreuten nach § 1831 Absatz 1, 2. eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne des § 1831 Absatz 4, unabhängig davon, wo der Betreute sich aufhält, 3. die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts des Betreuten im Ausland, 4. die Bestimmung des Umgangs des Betreuten, 5. die Entscheidung über die Telekommunikation des Betreuten einschließlich seiner elektronischen Kommunikation, 6. die Entscheidung über die Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten der Post des Betreuten.
(3) Einem Betreuer können unter den Voraussetzungen des § 1820 Absatz 3 auch die Aufgabenbereiche der Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten sowie zusätzlich der Geltendmachung von Auskunfts- und Rechenschaftsansprüchen des Betreuten gegenüber Dritten übertragen werden (Kontrollbetreuer).
§ 1816 Eignung und Auswahl des Betreuers; Berücksichtigung der Wünsche des Volljährigen
(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen Betreuer, der geeignet ist, in dem gerichtlich angeordneten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 rechtlich zu besorgen und insbesondere in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten.
(2) Wünscht der Volljährige eine Person als Betreuer, so ist diesem Wunsch zu entsprechen, es sei denn, die gewünschte Person ist zur Führung der Betreuung nach Absatz 1 nicht geeignet. Lehnt der Volljährige eine bestimmte Person als Betreuer ab, so ist diesem Wunsch zu entsprechen, es sei denn, die Ablehnung bezieht sich nicht auf die Person des Betreuers, sondern auf die Bestellung eines Betreuers als solche. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Wünsche, die der Volljährige vor Einleitung des Betreuungsverfahrens geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen erkennbar nicht festhalten will. Wer von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers für einen Volljährigen Kenntnis erlangt und ein Dokument besitzt, in dem der Volljährige für den Fall, dass für ihn ein Betreuer bestellt werden muss, Wünsche zur Auswahl des Betreuers oder zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat (Betreuungsverfügung), hat die Betreuungsverfügung dem Betreuungsgericht zu übermitteln.
(3) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann oder ist die gewünschte Person nicht geeignet, so sind bei der Auswahl des Betreuers die familiären Beziehungen des Volljährigen, insbesondere zum Ehegatten, zu Eltern und zu Kindern, seine persönlichen Bindungen sowie die Gefahr von Interessenkonflikten zu berücksichtigen.
(4) Eine Person, die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung zu dem Volljährigen hat, soll nur dann zum ehrenamtlichen Betreuer bestellt werden, wenn sie mit einem nach § 14 des Betreuungsorganisationsgesetzes anerkannten Betreuungsverein oder mit der zuständigen Behörde eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder § 5 Absatz 2 Satz 3 des Betreuungsorganisationsgesetzes geschlossen hat.
(5) Ein beruflicher Betreuer nach § 19 Absatz 2 des Betreuungsorganisationsgesetzes soll nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn keine geeignete Person für die ehrenamtliche Führung der Betreuung zur Verfügung steht. Bei der Entscheidung, ob ein bestimmter beruflicher Betreuer bestellt wird, sind die Anzahl und der Umfang der bereits von diesem zu führenden Betreuungen zu berücksichtigen.
(6) Eine Person, die zu einem Träger von Einrichtungen oder Diensten, der in der Versorgung des Volljährigen tätig ist, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden. Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall die konkrete Gefahr einer Interessenkollision nicht besteht.
§ 1817 Mehrere Betreuer; Verhinderungsbetreuer; Ergänzungsbetreuer
(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die Angelegenheiten des Betreuten hierdurch besser besorgt werden können. In diesem Falle bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Aufgabenbereich betraut wird. Mehrere berufliche Betreuer werden außer in den in den Absätzen 2, 4 und 5 geregelten Fällen nicht bestellt.
(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten ist stets ein besonderer Betreuer zu bestellen (Sterilisationsbetreuer).
(3) Sofern mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenbereich betraut werden, können sie diese Angelegenheiten des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es sei denn, dass das Betreuungsgericht etwas anderes bestimmt hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.
(4) Das Betreuungsgericht kann auch vorsorglich einen Verhinderungsbetreuer bestellen, der die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen hat, soweit der Betreuer aus tatsächlichen Gründen verhindert ist. Für diesen Fall kann auch ein anerkannter Betreuungsverein zum Verhinderungsbetreuer bestellt werden, ohne dass die Voraussetzungen des § 1818 Absatz 1 Satz 1 vorliegen.
(5) Soweit ein Betreuer aus rechtlichen Gründen gehindert ist, einzelne Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, hat das Betreuungsgericht hierfür einen Ergänzungsbetreuer zu bestellen.
§ 1818 Betreuung durch Betreuungsverein oder Betreuungsbehörde
(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer, wenn der Volljährige dies wünscht, oder wenn er durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinreichend betreut werden kann. Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Betreuungsvereins.
(2) Der Betreuungsverein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung einzelnen Personen. Vorschlägen des Volljährigen hat er hierbei zu entsprechen, wenn nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Der Betreuungsverein teilt dem Betreuungsgericht alsbald, spätestens binnen zwei Wochen nach seiner Bestellung, mit, wem er die Wahrnehmung der Betreuung übertragen hat. Die Sätze 2 und 3 gelten bei einem Wechsel der Person, die die Betreuung für den Betreuungsverein wahrnimmt, entsprechend.
(3) Werden dem Betreuungsverein Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann, so hat er dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen.
(4) Kann der Volljährige weder durch eine oder mehrere natürliche Personen noch durch einen Betreuungsverein hinreichend betreut werden, so bestellt das Betreuungsgericht die zuständige Betreuungsbehörde zum Betreuer. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(5) Die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation darf weder einem Betreuungsverein noch einer Betreuungsbehörde übertragen werden.
§ 1819 Übernahmepflicht; weitere Bestellungsvoraussetzungen
(1) Die vom Betreuungsgericht ausgewählte Person ist verpflichtet, die Betreuung zu übernehmen, wenn ihr die Übernahme unter Berücksichtigung ihrer familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden kann. (2) Die ausgewählte Person darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, wenn sie sich zur Übernahme der Betreuung bereit erklärt hat.
(3) Ein Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins, der dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilligung des Betreuungsvereins bestellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer Betreuungsbehörde, der als Betreuer bestellt wird (Behördenbetreuer).
§ 1820 Vorsorgevollmacht und Kontrollbetreuung
(1) Wer von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers für einen Volljährigen Kenntnis erlangt und ein Dokument besitzt, in dem der Volljährige eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, hat das Betreuungsgericht hierüber unverzüglich zu unterrichten. Das Betreuungsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen.
(2) Folgende Maßnahmen eines Bevollmächtigten setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst: 1. die Einwilligung sowie ihr Widerruf oder die Nichteinwilligung in Maßnahmen nach § 1829 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, 2. die Unterbringung nach § 1831 und die Einwilligung in Maßnahmen nach § 1831 Absatz 4, 3. die Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach § 1832 und die Verbringung nach § 1832 Absatz 4.
(3) Das Betreuungsgericht bestellt einen Kontrollbetreuer, wenn die Bestellung erforderlich ist, weil 1. der Vollmachtgeber aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage ist, seine Rechte gegenüber dem Bevollmächtigten auszuüben, und 2. aufgrund konkreter Anhaltspunkte davon auszugehen ist, dass der Bevollmächtigte die Angelegenheiten des Vollmachtgebers nicht entsprechend der Vereinbarung oder dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Vollmachtgebers besorgt.
(4) Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Bevollmächtigte die ihm erteilte Vollmacht nicht ausüben darf und die Vollmachtsurkunde an den Betreuer herauszugeben hat, wenn 1. die dringende Gefahr besteht, dass der Bevollmächtigte nicht den Wünschen des Vollmachtgebers entsprechend handelt und dadurch die Person des Vollmachtgebers oder dessen Vermögen erheblich gefährdet oder 2. der Bevollmächtigte den Betreuer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben behindert. Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht mehr vor, hat das Betreuungsgericht die Anordnung aufzuheben und den Betreuer zu verpflichten, dem Bevollmächtigten die Vollmachtsurkunde herauszugeben, wenn die Vollmacht nicht erloschen ist.
(5) Der Betreuer darf eine Vollmacht oder einen Teil einer Vollmacht, die den Bevollmächtigten zu Maßnahmen der Personensorge oder zu Maßnahmen in wesentlichen Bereichen der Vermögenssorge ermächtigt, nur widerrufen, wenn das Festhalten an der Vollmacht eine künftige Verletzung der Person oder des Vermögens des Betreuten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit und in erheblicher Schwere befürchten lässt und mildere Maßnahmen nicht zur Abwehr eines Schadens für den Betreuten geeignet erscheinen. Der Widerruf bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Mit der Genehmigung des Widerrufs einer Vollmacht kann das Betreuungsgericht die Herausgabe der Vollmachtsurkunde an den Betreuer anordnen.
Untertitel 2
Führung der Betreuung
Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1821 Pflichten des Betreuers; Wünsche des Betreuten
(1) Der Betreuer nimmt alle Tätigkeiten vor, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen. Er unterstützt den Betreuten dabei, seine Angelegenheiten rechtlich selbst zu besorgen, und macht von seiner Vertretungsmacht nach § 1823 nur Gebrauch, soweit dies erforderlich ist.
(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, dass dieser im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Leben nach seinen Wünschen gestalten kann. Hierzu hat der Betreuer die Wünsche des Betreuten festzustellen. Diesen hat der Betreuer vorbehaltlich des Absatzes 3 zu entsprechen und den Betreuten bei deren Umsetzung rechtlich zu unterstützen. Dies gilt auch für die Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will.
(3) Den Wünschen des Betreuten hat der Betreuer nicht zu entsprechen, soweit 1. die Person des Betreuten oder dessen Vermögen hierdurch erheblich gefährdet würde und der Betreute diese Gefahr aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann oder 2. dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist.
(4) Kann der Betreuer die Wünsche des Betreuten nicht feststellen oder darf er ihnen nach Absatz 3 Nummer 1 nicht entsprechen, hat er den mutmaßlichen Willen des Betreuten aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln und ihm Geltung zu verschaffen. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. Bei der Feststellung des mutmaßlichen Willens soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.
(5) Der Betreuer hat den erforderlichen persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten, sich regelmäßig einen persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen und dessen Angelegenheiten mit ihm zu besprechen.
(6) Der Betreuer hat innerhalb seines Aufgabenkreises dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt werden, die Fähigkeit des Betreuten, seine eigenen Angelegenheiten zu besorgen, wiederherzustellen oder zu verbessern.
§ 1822 Auskunftspflicht gegenüber nahestehenden Angehörigen
Der Betreuer hat nahestehenden Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten auf Verlangen Auskunft über dessen persönliche Lebensumstände zu erteilen, soweit dies einem nach § 1821 Absatz 2 bis 4 zu beachtenden Wunsch oder dem mutmaßlichen Willen des Betreuten entspricht und dem Betreuer zuzumuten ist.
§ 1823 Vertretungsmacht des Betreuers
In seinem Aufgabenkreis kann der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
§ 1824 Ausschluss der Vertretungsmacht
(1) Der Betreuer kann den Betreuten nicht vertreten: 1. bei einem Rechtsgeschäft zwischen seinem Ehegatten oder einem seiner Verwandten in gerader Linie einerseits und dem Betreuten andererseits, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht, 2. bei einem Rechtsgeschäft, das die Übertragung oder Belastung einer durch Pfandrecht, Hypothek, Schiffshypothek oder Bürgschaft gesicherten Forderung des Betreuten gegen den Betreuer oder die Aufhebung oder Minderung dieser Sicherheit zum Gegenstand hat oder die Verpflichtung des Betreuten zu einer solchen Übertragung, Belastung, Aufhebung oder Minderung begründet, 3. bei einem Rechtsstreit zwischen den in Nummer 1 bezeichneten Personen sowie bei einem Rechtsstreit über eine Angelegenheit der in Nummer 2 bezeichneten Art.(2) § 181 bleibt unberührt.
§ 1825 Einwilligungsvorbehalt
(1) Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Betreuungsgericht an, dass der Betreute zu einer Willenserklärung, die einen Aufgabenbereich des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf (Einwilligungsvorbehalt). Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Einwilligungsvorbehalt nicht angeordnet werden. Die §§ 108 bis 113, 131 Absatz 2 und § 210 gelten entsprechend.
(2) Ein Einwilligungsvorbehalt kann sich nicht erstrecken 1. auf Willenserklärungen, die auf Eingehung einer Ehe gerichtet sind, 2. auf Verfügungen von Todes wegen, 3. auf die Anfechtung eines Erbvertrags, 4. auf die Aufhebung eines Erbvertrags durch Vertrag und 5. auf Willenserklärungen, zu denen ein beschränkt Geschäftsfähiger nach den Vorschriften dieses Buches und des Buches 5 nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters bedarf.
(3) Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Betreute dennoch nicht der Einwilligung seines Betreuers, wenn die Willenserklärung dem Betreuten lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt. Soweit das Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies auch, wenn die Willenserklärung eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft.
(4) Auch für einen Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr vollendet hat, kann das Betreuungsgericht einen Einwilligungsvorbehalt anordnen, wenn anzunehmen ist, dass ein solcher bei Eintritt der Volljährigkeit erforderlich wird.
§ 1826 Haftung des Betreuers
(1) Der Betreuer ist dem Betreuten für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn der Betreuer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.(2) Sind für den Schaden mehrere Betreuer nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.
(3) Ist ein Betreuungsverein als Betreuer bestellt, so ist er dem Betreuten für ein Verschulden des Mitglieds oder des Mitarbeiters in gleicher Weise verantwortlich wie für ein Verschulden eines verfassungsmäßig berufenen Vertreters.
Kapitel 2
Personenangelegenheiten
§ 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation des Betreuten zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation des Betreuten zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.
(4) Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit einer Patientenverfügung hinweisen und ihn auf dessen Wunsch bei der Errichtung einer Patientenverfügung unterstützen.
(5) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.
(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
§ 1828 Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach § 1827 zu treffende Entscheidung.
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1827 Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1827 Absatz 2 soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
§ 1829 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.
(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht.
(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1827 festgestellten Willen des Betreuten entspricht.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 Nummer 1 für einen Bevollmächtigten entsprechend.
§ 1830 Sterilisation
(1) Die Einwilligung eines Sterilisationsbetreuers in eine Sterilisation des Betreuten, in die dieser nicht selbst einwilligen kann, ist nur zulässig, wenn 1. die Sterilisation dem natürlichen Willen des Betreuten entspricht, 2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird, 3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen würde, 4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren zu erwarten wäre, die nicht auf zumutbare Weise abgewendet werden könnte, und 5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden kann.
(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Die Sterilisation darf erst zwei Wochen nach Wirksamkeit der Genehmigung durchgeführt werden. Bei der Sterilisation ist stets der Methode der Vorzug zu geben, die eine Refertilisierung zulässt.
§ 1831 Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie erforderlich ist, weil 1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maßnahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann.
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.
(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 Nummer 2 für einen Bevollmächtigten entsprechend.
§ 1832 Ärztliche Zwangsmaßnahmen
(1) Widerspricht eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff dem natürlichen Willen des Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann der Betreuer in die ärztliche Zwangsmaßnahme nur einwilligen, wenn 1. die ärztliche Zwangsmaßnahme notwendig ist, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden vom Betreuten abzuwenden, 2. der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, 3. die ärztliche Zwangsmaßnahme dem nach § 1827 zu beachtenden Willen des Betreuten entspricht, 4. zuvor ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks versucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen, 5. der drohende erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine andere den Betreuten weniger belastende Maßnahme abgewendet werden kann, 6. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt und 7. die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus, in dem die gebotene medizinische Versorgung des Betreuten einschließlich einer erforderlichen Nachbehandlung sichergestellt ist, durchgeführt wird.§ 1867 ist nur anwendbar, wenn der Betreuer an der Erfüllung seiner Pflichten verhindert ist.
(2) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts.
(3) Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat den Widerruf dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen.
(4) Kommt eine ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht, so gilt für die Verbringung des Betreuten gegen seinen natürlichen Willen zu einem stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus § 1831 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und 3 Satz 1 entsprechend.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 Nummer 3 für einen Bevollmächtigten entsprechend.
§ 1833 Aufgabe von Wohnraum des Betreuten
(1) Eine Aufgabe von Wohnraum, der vom Betreuten selbst genutzt wird, durch den Betreuer ist nur nach Maßgabe des § 1821 Absatz 2 bis 4 zulässig. Eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 liegt insbesondere dann vor, wenn eine Finanzierung des Wohnraums trotz Ausschöpfung aller dem Betreuten zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich ist oder eine häusliche Versorgung trotz umfassender Zuhilfenahme aller ambulanten Dienste zu einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung des Betreuten führen würde.
(2) Beabsichtigt der Betreuer, vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum aufzugeben, so hat er dies unter Angabe der Gründe und der Sichtweise des Betreuten dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. Ist mit einer Aufgabe des Wohnraums aus anderen Gründen zu rechnen, so hat der Betreuer auch dies sowie die von ihm beabsichtigten Maßnahmen dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen, wenn sein Aufgabenkreis die entsprechende Angelegenheit umfasst.
(3) Der Betreuer bedarf bei vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum der Genehmigung des Betreuungsgerichts 1. zur Kündigung des Mietverhältnisses, 2. zu einer Willenserklärung, die auf die Aufhebung des Mietverhältnisses gerichtet ist, 3. zur Vermietung solchen Wohnraums und4.zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern dies mit der Aufgabe des Wohnraums verbunden ist. Die §§ 1855 bis 1858 gelten entsprechend.
§ 1834 Bestimmung des Umgangs und des Aufenthalts des Betreuten
(1) Den Umgang des Betreuten mit anderen Personen darf der Betreuer mit Wirkung für und gegen Dritte nur bestimmen, wenn der Betreute dies wünscht oder ihm eine konkrete Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 droht.
(2) Die Bestimmung des Aufenthalts umfasst das Recht, den Aufenthalt des Betreuten auch mit Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen und, falls erforderlich, die Herausgabe des Betreuten zu verlangen.
(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entscheidet das Betreuungsgericht auf Antrag.
Kapitel 3
Vermögensangelegenheiten
Unterkapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1835 Vermögensverzeichnis
(1) Soweit die Verwaltung des Vermögens des Betreuten zum Aufgabenkreis des Betreuers gehört, hat er zum Zeitpunkt seiner Bestellung ein Verzeichnis über das Vermögen des Betreuten zu erstellen und dieses dem Betreuungsgericht mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit einzureichen. Das Vermögensverzeichnis soll auch Angaben zu den regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Betreuten enthalten. Der Betreuer hat das Vermögensverzeichnis um dasjenige Vermögen zu ergänzen, das der Betreute später hinzuerwirbt. Mehrere Betreuer haben das Vermögensverzeichnis gemeinsam zu erstellen, soweit sie das Vermögen gemeinsam verwalten.
(2) Der Betreuer hat seine Angaben im Vermögensverzeichnis in geeigneter Weise zu belegen.
(3) Soweit es für die ordnungsgemäße Erstellung des Vermögensverzeichnisses erforderlich und mit Rücksicht auf das Vermögen des Betreuten angemessen ist, kann der Betreuer die zuständige Betreuungsbehörde, einen zuständigen Beamten, einen Notar oder einen Sachverständigen zur Erstellung des Verzeichnisses hinzuziehen.
(4) Bestehen nach den Umständen des Einzelfalls konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit des Vermögensverzeichnisses durch eine dritte Person zum Schutz des Vermögens des Betreuten oder zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten erforderlich ist, kann das Betreuungsgericht eine dritte Person als Zeuge bei der Erstellung des Vermögensverzeichnisses, insbesondere bei einer Inaugenscheinnahme von Vermögensgegenständen, hinzuziehen. Für die Erstattung der Aufwendungen der dritten Person sind die Vorschriften über die Entschädigung von Zeugen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz anzuwenden. Der Betreuer hat der dritten Person die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Die dritte Person hat dem Betreuungsgericht über die Erstellung des Vermögensverzeichnisses und insbesondere das Ergebnis der Inaugenscheinnahme zu berichten.
(5) Ist das eingereichte Vermögensverzeichnis ungenügend, so kann das Betreuungsgericht anordnen, dass das Vermögensverzeichnis durch die zuständige Betreuungsbehörde oder einen Notar aufgenommen wird.(6) Das Betreuungsgericht hat das Vermögensverzeichnis dem Betreuten zur Kenntnis zu geben, es sei denn, dadurch sind erhebliche Nachteile für dessen Gesundheit zu besorgen oder er ist offensichtlich nicht in der Lage, das Vermögensverzeichnis zur Kenntnis zu nehmen.
§ 1836 Trennungsgebot; Verwendung des Vermögens für den Betreuer
(1) Der Betreuer hat das Vermögen des Betreuten getrennt von seinem eigenen Vermögen zu halten. Dies gilt nicht für das bei Bestellung des Betreuers bestehende und das während der Betreuung hinzukommende gemeinschaftliche Vermögen des Betreuers und des Betreuten, wenn das Betreuungsgericht nichts anderes anordnet.
(2) Der Betreuer darf das Vermögen des Betreuten nicht für sich verwenden. Dies gilt nicht, wenn die Betreuung ehrenamtlich geführt wird und zwischen dem Betreuten und dem Betreuer eine Vereinbarung über die Verwendung getroffen wurde. Verwendungen nach Satz 2 sind unter Darlegung der Vereinbarung dem Betreuungsgericht anzuzeigen.
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für Haushaltsgegenstände und das Verfügungsgeld im Sinne des § 1839, wenn der Betreuer mit dem Betreuten einen gemeinsamen Haushalt führt oder geführt hat und die Verwendung dem Wunsch oder mutmaßlichen Willen des Betreuten entspricht.
§ 1837 Vermögensverwaltung durch den Betreuer bei Erbschaft und Schenkung
(1) Der Betreuer hat das Vermögen des Betreuten, das dieser von Todes wegen erwirbt, das ihm unentgeltlich durch Zuwendung auf den Todesfall oder unter Lebenden von einem Dritten zugewendet wird, nach den Anordnungen des Erblassers oder des Zuwendenden, soweit diese sich an den Betreuer richten, zu verwalten, wenn die Anordnungen von dem Erblasser durch letztwillige Verfügung oder von dem Dritten bei der Zuwendung getroffen worden sind.
(2) Das Betreuungsgericht kann die Anordnungen des Erblassers oder des Zuwendenden aufheben, wenn ihre Befolgung das Vermögen des Betreuten erheblich gefährden würde. Solange der Zuwendende lebt, ist zu einer Abweichung von den Anordnungen seine Zustimmung erforderlich und genügend. Ist er zur Abgabe einer Erklärung dauerhaft außerstande oder ist sein Aufenthalt dauerhaft unbekannt, so kann das Betreuungsgericht unter Beachtung der Voraussetzungen von Satz 1 die Zustimmung ersetzen.
Unterkapitel 2
Verwaltung von Geld, Wertpapieren und Wertgegenständen
§ 1838 Pflichten des Betreuers in Vermögensangelegenheiten
(1) Der Betreuer hat die Vermögensangelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 wahrzunehmen. Es wird vermutet, dass eine Wahrnehmung der Vermögensangelegenheiten nach den §§ 1839 bis 1843 dem mutmaßlichen Willen des Betreuten nach § 1821 Absatz 4 entspricht, wenn keine hinreichenden konkreten Anhaltspunkte für einen hiervon abweichenden mutmaßlichen Willen bestehen.
(2) Soweit die nach Absatz 1 Satz 1 gebotene Wahrnehmung der Vermögensangelegenheiten von den in den §§ 1839 bis 1843 festgelegten Grundsätzen abweicht, hat der Betreuer dies dem Betreuungsgericht unverzüglich unter Darlegung der Wünsche des Betreuten anzuzeigen. Das Betreuungsgericht kann die Anwendung der §§ 1839 bis 1843 oder einzelner Vorschriften ausdrücklich anordnen, wenn andernfalls eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 zu besorgen wäre.
§ 1839 Bereithaltung von Verfügungsgeld
(1) Geld des Betreuten, das der Betreuer für dessen Ausgaben benötigt (Verfügungsgeld), hat er auf einem Girokonto des Betreuten bei einem Kreditinstitut bereitzuhalten. Ausgenommen ist Bargeld im Sinne von § 1840 Absatz 2.
(2) Absatz 1 steht einer Bereithaltung von Verfügungsgeld auf einem gesonderten zur verzinslichen Anlage geeigneten Konto des Betreuten im Sinne von § 1841 Absatz 2 nicht entgegen.
§ 1840 Bargeldloser Zahlungsverkehr
(1) Der Betreuer hat den Zahlungsverkehr für den Betreuten bargeldlos unter Verwendung des gemäß § 1839 Absatz 1 Satz 1 zu unterhaltenden Girokontos durchzuführen.
(2) Von Absatz 1 sind ausgenommen 1. im Geschäftsverkehr übliche Barzahlungen und 2. Auszahlungen an den Betreuten.
§ 1841 Anlagepflicht
(1) Geld des Betreuten, das nicht für Ausgaben nach § 1839 benötigt wird, hat der Betreuer anzulegen (Anlagegeld).
(2) Der Betreuer soll das Anlagegeld auf einem zur verzinslichen Anlage geeigneten Konto des Betreuten bei einem Kreditinstitut (Anlagekonto) anlegen.
§ 1842 Voraussetzungen für das Kreditinstitut
Das Kreditinstitut muss bei Anlagen nach den §§ 1839 und 1841 Absatz 2 einer für die jeweilige Anlage ausreichenden Sicherungseinrichtung angehören.
§ 1843 Depotverwahrung und Hinterlegung von Wertpapieren
(1) Der Betreuer hat Wertpapiere des Betreuten im Sinne des § 1 Absatz 1 und 2 des Depotgesetzes bei einem Kreditinstitut in Einzel- oder Sammelverwahrung verwahren zu lassen.
(2) Sonstige Wertpapiere des Betreuten hat der Betreuer in einem Schließfach eines Kreditinstituts zu hinterlegen.
(3) Die Pflicht zur Depotverwahrung oder zur Hinterlegung besteht nicht, wenn diese nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Art der Wertpapiere zur Sicherung des Vermögens des Betreuten nicht geboten ist.
§ 1844 Hinterlegung von Wertgegenständen auf Anordnung des Betreuungsgerichts
Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Betreuer Wertgegenstände des Betreuten bei einer Hinterlegungsstelle oder einer anderen geeigneten Stelle hinterlegt, wenn dies zur Sicherung des Vermögens des Betreuten geboten ist.
§ 1845 Sperrvereinbarung
(1) Für Geldanlagen des Betreuten im Sinne von § 1841 Absatz 2 hat der Betreuer mit dem Kreditinstitut zu vereinbaren, dass er über die Anlage nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verfügen kann. Anlagen von Verfügungsgeld gemäß § 1839 Absatz 2 bleiben unberührt.
(2) Für Wertpapiere im Sinne von § 1843 Absatz 1 hat der Betreuer mit dem Verwahrer zu vereinbaren, dass er über die Wertpapiere und die Rechte aus dem Depotvertrag mit Ausnahme von Zinsen und Ausschüttungen nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verfügen kann. Der Betreuer hat mit dem Kreditinstitut zu vereinbaren, dass er die Öffnung des Schließfachs für Wertpapiere im Sinne des § 1843 Absatz 2 und die Herausgabe von nach § 1844 hinterlegten Wertgegenständen nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verlangen kann.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn ein Anlagekonto, ein Depot oder eine Hinterlegung des Betreuten bei der Bestellung des Betreuers unversperrt ist. Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht die Sperrvereinbarung anzuzeigen.
Unterkapitel 3
Anzeigepflichten
§ 1846 Anzeigepflichten bei der Geld- und Vermögensverwaltung
(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen, wenn er 1. ein Girokonto für den Betreuten eröffnet, 2. ein Anlagekonto für den Betreuten eröffnet, 3. ein Depot eröffnet oder Wertpapiere des Betreuten hinterlegt, 4. Wertpapiere des Betreuten gemäß § 1843 Absatz 3 nicht in einem Depot verwahrt oder hinterlegt.
(2) Die Anzeige hat insbesondere Angaben zu enthalten 1. zur Höhe des Guthabens auf dem Girokonto nach Absatz 1 Nummer 1, 2. zu Höhe und Verzinsung der Anlage gemäß Absatz 1 Nummer 2 sowie ihrer Bestimmung als Anlage- oder Verfügungsgeld, 3. zu Art, Umfang und Wert der depotverwahrten oder hinterlegten Wertpapiere gemäß Absatz 1 Nummer 3 sowie zu den sich aus ihnen ergebenden Aufwendungen und Nutzungen, 4. zu den Gründen, aus denen der Betreuer die Depotverwahrung oder Hinterlegung gemäß Absatz 1 Nummer 4 für nicht geboten erachtet, und wie die Wertpapiere verwahrt werden sollen, 5. zur Sperrvereinbarung.
§ 1847 Anzeigepflicht für Erwerbsgeschäfte
Der Betreuer hat Beginn, Art und Umfang eines neuen Erwerbsgeschäfts im Namen des Betreuten und die Aufgabe eines bestehenden Erwerbsgeschäfts des Betreuten beim Betreuungsgericht anzuzeigen.
Unterkapitel 4
Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte
§ 1848 Genehmigung einer anderen Anlegung von Geld
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn er Anlagegeld anders als auf einem Anlagekonto gemäß § 1841 Absatz 2 anlegt.
§ 1849 Genehmigung bei Verfügung über Rechte und Wertpapiere
(1) Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts zu einer Verfügung über 1. ein Recht, kraft dessen der Betreute eine Geldleistung oder die Leistung eines Wertpapiers verlangen kann, 2. ein Wertpapier des Betreuten, 3. einen hinterlegten Wertgegenstand des Betreuten. Das gleiche gilt für die Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen Verfügung.
(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht, 1. im Fall einer Geldleistung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, wenn der aus dem Recht folgende Zahlungsanspruch a) nicht mehr als 3 000 Euro beträgt, b) das Guthaben auf einem Girokonto des Betreuten betrifft, c) das Guthaben auf einem vom Betreuer für Verfügungsgeld ohne Sperrvereinbarung eröffneten Anlagekonto betrifft, d) zu den Nutzungen des Vermögens des Betreuten gehört oder e) auf Nebenleistungen gerichtet ist, 2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, wenn die Verfügung über das Wertpapier a) eine Nutzung des Vermögens des Betreuten darstellt, b) eine Umschreibung des Wertpapiers auf den Namen des Betreuten darstellt, 3. im Fall einer Verfügung nach Absatz 1 Satz 1, wenn die Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen Verfügung bereits durch das Betreuungsgericht genehmigt worden ist. Satz 1 Nummer 2 gilt entsprechend für die Eingehung einer Verpflichtung zu einer solchen Verfügung.
(3) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a ist nicht anzuwenden auf eine Verfügung über einen sich aus einer Geldanlage ergebenden Zahlungsanspruch, soweit er einer Sperrvereinbarung unterliegt, sowie über den sich aus der Einlösung eines Wertpapiers ergebenden Zahlungsanspruch. Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d ist nicht anzuwenden auf eine Verfügung über einen Zahlungsanspruch, der einer Sperrvereinbarung unterliegt und eine Kapitalnutzung betrifft.
(4) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Annahme der Leistung.
§ 1850 Genehmigung für Rechtsgeschäfte über Grundstücke und Schiffe
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 1. zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern die Genehmigung nicht bereits nach § 1833 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, 2. zur Verfügung über eine Forderung, die auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, auf Begründung oder Übertragung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Befreiung eines Grundstücks von einem solchen Recht gerichtet ist, 3. zur Verfügung über ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk oder über eine Forderung, die auf Übertragung des Eigentums an einem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk gerichtet ist, 4. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute unentgeltlich Wohnungs- oder Teileigentum erwirbt, 5. zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer der in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Verfügungen oder des in Nummer 4 bezeichneten Erwerbs sowie 6. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zum entgeltlichen Erwerb eines Grundstücks, eines eingetragenen Schiffes oder Schiffsbauwerks oder eines Rechts an einem Grundstück verpflichtet wird, sowie zur Verpflichtung zum entgeltlichen Erwerb einer Forderung auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, an einem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk oder auf Übertragung eines Rechts an einem Grundstück.
§ 1851 Genehmigung für erbrechtliche Rechtsgeschäfte
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 1. zur Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses, zum Verzicht auf die Geltendmachung eines Vermächtnisses oder Pflichtteilsanspruchs sowie zu einem Auseinandersetzungsvertrag, 2. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zu einer Verfügung über eine ihm angefallene Erbschaft, über seinen künftigen gesetzlichen Erbteil oder seinen künftigen Pflichtteil verpflichtet wird, 3. zu einer Verfügung über den Anteil des Betreuten an einer Erbschaft oder zu einer Vereinbarung, mit der der Betreute aus der Erbengemeinschaft ausscheidet, 4. zu einer Anfechtung eines Erbvertrags für den geschäftsunfähigen Betreuten als Erblasser gemäß § 2282 Absatz 2, 5. zum Abschluss eines Vertrags mit dem Erblasser über die Aufhebung eines Erbvertrags oder einer einzelnen vertragsmäßigen Verfügung gemäß § 2290, 6. zu einer Zustimmung zur testamentarischen Aufhebung einer in einem Erbvertrag mit dem Erblasser geregelten vertragsmäßigen Anordnung eines Vermächtnisses, einer Auflage sowie einer Rechtswahl gemäß § 2291, 7. zur Aufhebung eines zwischen Ehegatten oder Lebenspartnern geschlossenen Erbvertrags durch gemeinschaftliches Testament der Ehegatten oder Lebenspartner gemäß § 2292, 8. zu einer Rücknahme eines mit dem Erblasser geschlossenen Erbvertrags, der nur Verfügungen von Todes wegen enthält, aus der amtlichen oder notariellen Verwahrung gemäß § 2300 Absatz 2, 9. zum Abschluss oder zur Aufhebung eines Erb- oder Pflichtteilsverzichtsvertrags gemäß den §§ 2346, 2351 sowie zum Abschluss eines Zuwendungsverzichtsvertrags gemäß § 2352.
§ 1852 Genehmigung für handels- und gesellschaftsrechtliche Rechtsgeschäfte
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 1. zu einer Verfügung und zur Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen Verfügung, durch die der Betreute a) ein Erwerbsgeschäft oder b) einen Anteil an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft, die ein Erwerbsgeschäft betreibt,erwirbt oder veräußert, 2. zu einem Gesellschaftsvertrag, der zum Betrieb eines Erwerbsgeschäfts eingegangen wird, und 3. zur Erteilung einer Prokura.
§ 1853 Genehmigung bei Verträgen über wiederkehrende Leistungen
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 1. zum Abschluss eines Miet- oder Pachtvertrags oder zu einem anderen Vertrag, durch den der Betreute zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre dauern soll, und 2. zu einem Pachtvertrag über einen gewerblichen oder land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb.Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn der Betreute das Vertragsverhältnis ohne eigene Nachteile vorzeitig kündigen kann.
§ 1854 Genehmigung für sonstige Rechtsgeschäfte
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 1. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zu einer Verfügung über sein Vermögen im Ganzen verpflichtet wird, 2. zur Aufnahme von Geld auf den Kredit des Betreuten mit Ausnahme einer eingeräumten Überziehungsmöglichkeit für das auf einem Girokonto des Betreuten bei einem Kreditinstitut bereitzuhaltende Verfügungsgeld (§ 1839 Absatz 1), 3. zur Ausstellung einer Schuldverschreibung auf den Inhaber oder zur Eingehung einer Verbindlichkeit aus einem Wechsel oder einem anderen Papier, das durch Indossament übertragen werden kann, 4. zu einem Rechtsgeschäft, das auf Übernahme einer fremden Verbindlichkeit gerichtet ist, 5. zur Eingehung einer Bürgschaft, 6. zu einem Vergleich oder einer auf ein Schiedsverfahren gerichteten Vereinbarung, es sei denn, dass der Gegenstand des Streites oder der Ungewissheit in Geld schätzbar ist und den Wert von 6 000 Euro nicht übersteigt oder der Vergleich einem schriftlichen oder protokollierten gerichtlichen Vergleichsvorschlag entspricht, 7. zu einem Rechtsgeschäft, durch das die für eine Forderung des Betreuten bestehende Sicherheit aufgehoben oder gemindert oder die Verpflichtung dazu begründet wird, und 8. zu einer Schenkung oder unentgeltlichen Zuwendung, es sei denn, diese ist nach den Lebensverhältnissen des Betreuten angemessen oder als Gelegenheitsgeschenk üblich.
Unterkapitel 5
Genehmigungserklärung
§ 1855 Erklärung der Genehmigung
Das Betreuungsgericht kann die Genehmigung zu einem Rechtsgeschäft nur dem Betreuer gegenüber erklären.
§ 1856 Nachträgliche Genehmigung
(1) Schließt der Betreuer einen Vertrag ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts ab. Die Genehmigung sowie deren Verweigerung wird dem anderen Teil gegenüber erst wirksam, wenn ihm die wirksam gewordene Genehmigung oder Verweigerung durch den Betreuer mitgeteilt wird.
(2) Fordert der andere Teil den Betreuer zur Mitteilung darüber auf, ob die Genehmigung erteilt sei, so kann die Mitteilung der Genehmigung nur bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Empfang der Aufforderung erfolgen; wird die Genehmigung nicht mitgeteilt, so gilt sie als verweigert.
(3) Soweit die Betreuung aufgehoben oder beendet ist, tritt die Genehmigung des Betreuten an die Stelle der Genehmigung des Betreuungsgerichts.
§ 1857 Widerrufsrecht des Vertragspartners
Hat der Betreuer dem anderen Teil gegenüber wahrheitswidrig die Genehmigung des Betreuungsgerichts behauptet, so ist der andere Teil bis zur Mitteilung der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts zum Widerruf berechtigt, es sei denn, dass ihm das Fehlen der Genehmigung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt war.
§ 1858 Einseitiges Rechtsgeschäft
(1) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Betreuer ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts vornimmt, ist unwirksam.
(2) Nimmt der Betreuer mit Genehmigung des Betreuungsgerichts ein einseitiges Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Betreuer die Genehmigung nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist.
(3) Nimmt der Betreuer ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem Gericht oder einer Behörde ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts vor, so hängt die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts von der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts ab. Das Rechtsgeschäft wird mit Rechtskraft der Genehmigung wirksam. Der Ablauf einer gesetzlichen Frist wird während der Dauer des Genehmigungsverfahrens gehemmt. Die Hemmung endet mit Rechtskraft des Beschlusses über die Erteilung der Genehmigung. Das Betreuungsgericht teilt dem Gericht oder der Behörde nach Rechtskraft des Beschlusses die Erteilung oder Versagung der Genehmigung mit.
Unterkapitel 6
Befreiungen
§ 1859 Gesetzliche Befreiungen
(1) Befreite Betreuer sind entbunden 1. von der Pflicht zur Sperrvereinbarung nach § 1845, 2. von den Beschränkungen nach § 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, Satz 2 und 3. von der Pflicht zur Rechnungslegung nach § 1865.Sie haben dem Betreuungsgericht jährlich eine Übersicht über den Bestand des ihrer Verwaltung unterliegenden Vermögens des Betreuten (Vermögensübersicht) einzureichen. Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass die Vermögensübersicht in längeren, höchstens fünfjährigen Zeiträumen einzureichen ist.
(2) Befreite Betreuer sind 1. Verwandte in gerader Linie, 2. Geschwister, 3. Ehegatten, 4. der Betreuungsverein oder ein Vereinsbetreuer, 5. die Betreuungsbehörde oder ein Behördenbetreuer.Das Betreuungsgericht kann andere als die in Satz 1 genannten Betreuer von den in Absatz 1 Satz 1 genannten Pflichten befreien, wenn der Betreute dies vor der Bestellung des Betreuers schriftlich verfügt hat. Dies gilt nicht, wenn der Betreute erkennbar an diesem Wunsch nicht festhalten will.
(3) Das Betreuungsgericht hat die Befreiungen aufzuheben, wenn bei ihrer Fortgeltung eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 zu besorgen wäre.
§ 1860 Befreiungen auf Anordnung des Gerichts
(1) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den Beschränkungen nach den §§ 1841, 1845, 1848 und 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 ganz oder teilweise befreien, wenn der Wert des Vermögens des Betreuten ohne Berücksichtigung von Immobilien und Verbindlichkeiten 6 000 Euro nicht übersteigt.
(2) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den Beschränkungen nach den §§ 1848, 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 und nach § 1854 Nummer 2 bis 5 befreien, soweit mit der Vermögensverwaltung der Betrieb eines Erwerbsgeschäfts verbunden ist oder besondere Gründe der Vermögensverwaltung dies erfordern.
(3) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den Beschränkungen nach § 1845 Absatz 2, den §§ 1848 und 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 befreien, wenn ein Wertpapierdepot des Betreuten häufige Wertpapiergeschäfte erfordert und der Betreuer über hinreichende Kapitalmarktkenntnis und Erfahrung verfügt.
(4) Eine Befreiung gemäß den Absätzen 1 bis 3 kann das Betreuungsgericht nur anordnen, wenn eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 nicht zu besorgen ist.
(5) Das Betreuungsgericht hat eine Befreiung aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.
Untertitel 3
Beratung und Aufsicht durch das Betreuungsgericht
§ 1861 Beratung; Verpflichtung des Betreuers
(1) Das Betreuungsgericht berät den Betreuer über dessen Rechte und Pflichten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
(2) Der ehrenamtliche Betreuer wird alsbald nach seiner Bestellung mündlich verpflichtet, über seine Aufgaben unterrichtet und auf Beratungs- und Unterstützungsangebote hingewiesen. Das gilt nicht für solche ehrenamtlichen Betreuer, die mehr als eine Betreuung führen oder in den letzten zwei Jahren geführt haben.
§ 1862 Aufsicht durch das Betreuungsgericht
(1) Das Betreuungsgericht führt über die gesamte Tätigkeit des Betreuers die Aufsicht. Es hat dabei auf die Einhaltung der Pflichten des Betreuers zu achten und insbesondere bei Anordnungen nach Absatz 3, der Erteilung von Genehmigungen und einstweiligen Maßnahmen nach § 1867 den in § 1821 Absatz 2 bis 4 festgelegten Maßstab zu beachten.
(2) Das Betreuungsgericht hat den Betreuten persönlich anzuhören, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Betreuer pflichtwidrig den Wünschen des Betreuten nicht oder nicht in geeigneter Weise entspricht oder seinen Pflichten gegenüber dem Betreuten in anderer Weise nicht nachkommt, es sei denn, die persönliche Anhörung ist nicht geeignet oder nicht erforderlich, um die Pflichtwidrigkeit aufzuklären.
(3) Das Betreuungsgericht hat gegen Pflichtwidrigkeiten des Betreuers durch geeignete Gebote und Verbote einzuschreiten. Zur Befolgung seiner Anordnungen kann es den Betreuer durch die Festsetzung von Zwangsgeld anhalten. Gegen die Betreuungsbehörde, einen Behördenbetreuer oder einen Betreuungsverein wird kein Zwangsgeld festgesetzt.
(4) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vorschriften, welche die Aufsicht des Betreuungsgerichts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim Abschluss von Ausbildungs-, Dienst- oder Arbeitsverträgen betreffen, gegenüber der Betreuungsbehörde außer Anwendung bleiben.
§ 1863 Berichte über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten
(1) Mit Übernahme der Betreuung hat der Betreuer einen Bericht über die persönlichen Verhältnisse (Anfangsbericht) zu erstellen. Der Anfangsbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten zu enthalten: 1. persönliche Situation des Betreuten, 2. Ziele der Betreuung, bereits durchgeführte und beabsichtigte Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf § 1821 Absatz 6, und 3. Wünsche des Betreuten hinsichtlich der Betreuung.Sofern ein Vermögensverzeichnis gemäß § 1835 zu erstellen ist, ist dieses dem Anfangsbericht beizufügen. Der Anfangsbericht soll dem Betreuungsgericht innerhalb von drei Monaten nach Bestellung des Betreuers übersandt werden. Das Betreuungsgericht kann den Anfangsbericht mit dem Betreuten und dem Betreuer in einem persönlichen Gespräch erörtern.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Betreuung ehrenamtlich von einer Person mit einer familiären Beziehung oder persönlichen Bindung zum Betreuten geführt wird. In diesem Fall führt das Betreuungsgericht mit dem Betreuten auf dessen Wunsch oder in anderen geeigneten Fällen ein Anfangsgespräch zur Ermittlung der Sachverhalte nach Absatz 1 Satz 2. Der ehrenamtliche Betreuer soll an dem Gespräch teilnehmen. Die Pflicht zur Erstellung eines Vermögensverzeichnisses gemäß § 1835 bleibt unberührt.
(3) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten mindestens einmal jährlich zu berichten (Jahresbericht). Er hat den Jahresbericht mit dem Betreuten zu besprechen, es sei denn, davon sind erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betreuten zu besorgen oder dieser ist offensichtlich nicht in der Lage, den Inhalt des Jahresberichts zur Kenntnis zu nehmen. Der Jahresbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten zu enthalten: 1. Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten und der persönliche Eindruck vom Betreuten, 2. Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele und Darstellung der bereits durchgeführten und beabsichtigten Maßnahmen, insbesondere solcher gegen den Willen des Betreuten, 3. Gründe für die weitere Erforderlichkeit der Betreuung und des Einwilligungsvorbehalts, insbesondere auch hinsichtlich des Umfangs, 4. bei einer beruflich geführten Betreuung die Mitteilung, ob die Betreuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann, und5.die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten nach den Nummern 1 bis 4.
(4) Nach Beendigung der Betreuung hat der Betreuer einen abschließenden Bericht (Schlussbericht) zu erstellen, in dem die seit dem letzten Jahresbericht eingetretenen Änderungen der persönlichen Verhältnisse mitzuteilen sind. Der Schlussbericht ist dem Betreuungsgericht zu übersenden. Er hat Angaben zur Herausgabe des der Verwaltung des Betreuers unterliegenden Vermögens des Betreuten und aller im Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen zu enthalten.
§ 1864 Auskunfts- und Mitteilungspflichten des Betreuers
(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht auf dessen Verlangen jederzeit über die Führung der Betreuung und über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten Auskunft zu erteilen.
(2) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch für solche Umstände, 1. die eine Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts ermöglichen, 2. die eine Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers ermöglichen, 3. die die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers erfordern, 4. die die Bestellung eines weiteren Betreuers erfordern, 5. die die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts erfordern und 6. aus denen sich bei einer beruflich geführten Betreuung ergibt, dass die Betreuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann.
§ 1865 Rechnungslegung
(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die Vermögensverwaltung Rechnung zu legen, soweit sein Aufgabenkreis die Vermögensverwaltung umfasst.
(2) Die Rechnung ist jährlich zu legen. Das Rechnungsjahr wird vom Betreuungsgericht bestimmt.
(3) Die Rechnung soll eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthalten und über den Ab- und Zugang des vom Betreuer verwalteten Vermögens Auskunft geben. Das Betreuungsgericht kann Einzelheiten zur Erstellung der geordneten Zusammenstellung nach Satz 1 bestimmen. Es kann in geeigneten Fällen auf die Vorlage von Belegen verzichten. Verwaltet der Betreute im Rahmen des dem Betreuer übertragenen Aufgabenkreises einen Teil seines Vermögens selbst, so hat der Betreuer dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. Der Betreuer hat die Richtigkeit dieser Mitteilung durch eine Erklärung des Betreuten nachzuweisen oder, falls eine solche nicht beigebracht werden kann, die Richtigkeit an Eides statt zu versichern.
(4) Wird vom Betreuten ein Erwerbsgeschäft mit kaufmännischer Buchführung betrieben, so genügt als Rechnung ein aus den Büchern gezogener Jahresabschluss. Das Betreuungsgericht kann Vorlage der Bücher und sonstigen Belege verlangen.
§ 1866 Prüfung der Rechnung durch das Betreuungsgericht
(1) Das Betreuungsgericht hat die Rechnung sachlich und rechnerisch zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre Berichtigung und Ergänzung durch den Betreuer herbeizuführen.
(2) Die Möglichkeit der Geltendmachung streitig gebliebener Ansprüche zwischen Betreuer und Betreutem im Rechtsweg bleibt unberührt. Die Ansprüche können schon vor der Beendigung der Betreuung geltend gemacht werden.
§ 1867 Einstweilige Maßnahmen des Betreuungsgerichts
Bestehen dringende Gründe für die Annahme, dass die Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers gegeben sind, und konnte ein Betreuer noch nicht bestellt werden oder ist der Betreuer an der Erfüllung seiner Pflichten gehindert, so hat das Betreuungsgericht die dringend erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Untertitel 4
Beendigung, Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt
§ 1868 Entlassung des Betreuers
(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn dessen Eignung, die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt oder den erforderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten hat.
(2) Das Betreuungsgericht hat den beruflichen Betreuer zu entlassen, wenn dessen Registrierung nach § 27 Absatz 1 und 2 des Betreuungsorganisationsgesetzes widerrufen oder zurückgenommen wurde.
(3) Das Betreuungsgericht soll den beruflichen Betreuer, den Betreuungsverein, den Behördenbetreuer oder die Betreuungsbehörde entlassen, wenn der Betreute zukünftig ehrenamtlich betreut werden kann.
(4) Das Betreuungsgericht entlässt den Betreuer auf dessen Verlangen, wenn nach dessen Bestellung Umstände eingetreten sind, aufgrund derer ihm die Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann.
(5) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreute eine mindestens gleich geeignete Person, die zur Übernahme der Betreuung bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt.
(6) Der Vereinsbetreuer ist auch dann zu entlassen, wenn der Betreuungsverein dies beantragt. Wünscht der Betreute die Fortführung der Betreuung durch den bisherigen Vereinsbetreuer, so kann das Betreuungsgericht statt der Entlassung des Vereinsbetreuers mit dessen Einverständnis feststellen, dass dieser die Betreuung künftig als Privatperson weiterführt. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Behördenbetreuer entsprechend.
(7) Der Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde ist als Betreuer zu entlassen, sobald der Betreute durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann. Dies gilt für den Betreuungsverein nicht, wenn der Wunsch des Betreuten dem entgegensteht.
§ 1869 Bestellung eines neuen Betreuers
Mit der Entlassung des Betreuers oder nach dessen Tod ist ein neuer Betreuer zu bestellen.
§ 1870 Ende der Betreuung
Die Betreuung endet mit der Aufhebung der Betreuung durch das Betreuungsgericht oder mit dem Tod des Betreuten.
§ 1871 Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt
(1) Die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Fallen die Voraussetzungen nur für einen Teil der Aufgabenbereiche des Betreuers weg, so ist dessen Aufgabenkreis einzuschränken.
(2) Ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die Betreuung auf dessen Antrag wieder aufzuheben, es sei denn, die Aufrechterhaltung der Betreuung ist auch unter Berücksichtigung von § 1814 Absatz 2 erforderlich. Dies gilt für die Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers entsprechend.
(3) Der Aufgabenkreis des Betreuers ist zu erweitern, wenn dies erforderlich wird. Die Vorschriften über die Bestellung des Betreuers gelten hierfür entsprechend.
(4) Für den Einwilligungsvorbehalt gelten die Absätze 1 und 3 entsprechend.
§ 1872 Herausgabe von Vermögen und Unterlagen; Schlussrechnungslegung
(1) Endet die Betreuung, hat der Betreuer das seiner Verwaltung unterliegende Vermögen und alle im Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen an den Betreuten, dessen Erben oder sonstigen Berechtigten herauszugeben.
(2) Eine Schlussrechnung über die Vermögensverwaltung hat der Betreuer nur zu erstellen, wenn der Berechtigte nach Absatz 1 dies verlangt. Auf dieses Recht ist der Berechtigte durch den Betreuer vor Herausgabe der Unterlagen hinzuweisen. Die Frist zur Geltendmachung des Anspruchs beträgt sechs Wochen nach Zugang des Hinweises. Der Berechtigte hat dem Betreuungsgericht sein Verlangen gegenüber dem Betreuer mitzuteilen.
(3) Ist der Betreute sechs Monate nach Ende der Betreuung unbekannten Aufenthalts oder sind dessen Erben nach Ablauf dieser Frist unbekannt oder unbekannten Aufenthalts und ist auch kein sonstiger Berechtigter vorhanden, hat der Betreuer abweichend von Absatz 2 eine Schlussrechnung zu erstellen.
(4) Bei einem Wechsel des Betreuers hat der bisherige Betreuer das seiner Verwaltung unterliegende Vermögen und alle im Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen an den neuen Betreuer herauszugeben. Über die Verwaltung seit der letzten beim Betreuungsgericht eingereichten Rechnungslegung hat er Rechenschaft durch eine Schlussrechnung abzulegen.
(5) War der Betreuer bei Beendigung seines Amtes gemäß § 1859 befreit, genügt zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den Absätzen 2 und 4 Satz 2 die Erstellung einer Vermögensübersicht mit einer Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben seit der letzten Vermögensübersicht. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Vermögensübersicht ist an Eides statt zu versichern.
§ 1873 Rechnungsprüfung
(1) Der Betreuer hat eine nach § 1872 von ihm zu erstellende Schlussrechnung oder Vermögensübersicht beim Betreuungsgericht einzureichen. Das Betreuungsgericht übersendet diese an den Berechtigten, soweit dieser bekannt ist oder rechtlich vertreten wird und kein Fall des § 1872 Absatz 3 vorliegt.
(2) Das Betreuungsgericht hat die Schlussrechnung oder die Vermögensübersicht sachlich und rechnerisch zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre Ergänzung herbeizuführen. Das Betreuungsgericht übersendet das Ergebnis seiner Prüfung nach Satz 1 an den Berechtigten.
(3) Endet die Betreuung und liegt kein Fall des § 1872 Absatz 3 vor, so gilt Absatz 2 nur dann, wenn der Berechtigte binnen sechs Wochen nach Zugang der Schlussrechnung oder der Vermögensübersicht deren Prüfung verlangt. Über dieses Recht ist der Berechtigte bei der Übersendung nach Absatz 1 Satz 2 zu belehren. Nach Ablauf der Frist kann eine Prüfung durch das Betreuungsgericht nicht mehr verlangt werden.
§ 1874 Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten nach Beendigung der Betreuung
(1) Der Betreuer darf die Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten fortführen, bis er von der Beendigung der Betreuung Kenntnis erlangt oder diese kennen muss. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis nicht berufen, wenn er bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts die Beendigung kennt oder kennen muss.
(2) Endet die Betreuung durch den Tod des Betreuten, so hat der Betreuer im Rahmen des ihm übertragenen Aufgabenkreises die Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, zu besorgen, bis der Erbe diese besorgen kann.
Was ist eine Vorsorgevollmacht?
Lange dachte ich selbst immer, Vorsorgevollmacht? Patientenverfügung?, dass mache ich irgendwann einmal. Seit einem Jahr berate ich nun Menschen zu diesem Thema und musste mich dafür selbstverständlich umfassend informieren. Im Grunde rate ich nun dazu, sich mit dem Thema Vorsorgevollmacht zu beschäftigen, sobald man volljährig wird.
Die Vorsorgevollmacht ist ein Mittel, handlungsfähig zu sein, wenn ich selber, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr handlungsfähig bin. Ich sorge im Vorhinein dafür, dass eine Person meines Vertrauens stellvertretend für mich handeln darf.
Ein praktisches, wenn auch deprimierendes Beispiel:
Ein junger Mensch verunfallt an seinem 18ten Geburtstag mit dem Auto und „landet“ auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Durch ärztliche Maßnahmen konnte sein Leben gerettet werden, er bleibt jedoch ohne Weiterbehandlung bewusstlos.
Dadurch, dass es im deutschen Recht keinerlei automatische Bevollmächtigung gibt, weder durch leibliche Eltern, Kinder, Geschwister, noch durch Ehepartner, gibt es hier niemanden, der eine ärztliche Aufklärung oder Behandlung unterschreiben und damit genehmigen darf. Ganz eng gesehen, dürfte ein Arzt den Eltern dieses jungen Menschen nicht einmal eine Auskunft geben.
Das Krankenhaus wird sich nun automatisch an das zuständige Amts-, bzw. Betreuungsgericht wenden. Das Gericht prüft zunächst, ob in einem zentralen Register eine Vorsorgevollmacht hinterlegt ist. Ist dies nicht der Fall, wird das Gericht eine*n gesetzliche*n Betreuer*in bestellen. In der Regel werden nahe Verwandte, wie zum Beispiel die Eltern dieses Menschen, dann als sogenannte ehrenamtliche gesetzliche Betreuer bestellt. Damit haben sie eine Handlungsvollmacht und dürfen nun die medizinische Situation mit den Ärzten besprechen und ggfls. einer Operation zustimmen.
Um zu verhindern, dass es zu einer solchen gesetzlichen Betreuung kommt, gibt es die Vorsorgevollmacht. In einer solchen bringt man seinen Willen zum Ausdruck, dass jemand anderer stellvertretend und in meinem Sinne Entscheidungen treffen und Rechtsgeschäfte tätigen darf, jedoch nur für den Fall, dass man das selber nicht mehr tun kann. Eine solche Vollmacht verliert ihre Gültigkeit, wenn ich selber wieder einwilligungsfähig bin und meine Entscheidungen selber wieder kommunizieren kann.
(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)m§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters)
Vollmachten sind grundsätzlich formfrei zulässig, können also theoretisch mündlich erteilt werden. Schriftform wird allerdings im Rechtsverkehr allgemein erwartet. (https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsorgevollmacht) Vor allem wenn Sie als Bevollmächtigter mit Ämtern und Behörden zu tun haben, müssen Sie immer die Vorsorgevollmacht im Original vorlegen können.
Aus den Erfahrungen meiner Arbeit als gesetzlicher Betreuer empfehle ich, eine solche Vollmacht recht detailliert anzulegen. Auf der Vorlage der Vorsorgevollmacht des Betreuungsvereines der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e.V. haben wir die Bereiche, in denen jemand möglicherweise vertretend handeln muss, getrennt voneinander aufgeführt. Wir haben uns dabei an den sogenannten Aufgabenkreisen eines gesetzlichen Betreuers orientiert: Gesundheit, Vermögen, Ämter und Behörden, Postverkehr, Aufenthalt und Mietangelegenheiten.
Grundsätzlich ist jedoch zu bedenken, dass ein Bevollmächtigter nicht wirklich alles entscheiden darf. Bestimmte Angelegenheiten sind zusätzlich betreuungsgerichtlich genehmigungspflichtig. Immer wenn es um freiheitsentziehende Maßnahmen geht, dauerhafte Bettgitter, Fixierungen, oder gar Behandlungen gegen den Willen einer Person, oder wenn es um Geldgeschäfte „höherer Ordnung“ geht, z.B. der Verkauf von Häusern oder Grundstücken, bedarf es zusätzlich der Prüfung und der Erlaubnis des zuständigen Betreuungsgerichtes. Außerdem erkennen Banken eine Vorsorgevollmacht nicht alleinig an. Ich empfehle in meinen Beratungen daher immer, zusätzlich zur Vorsorgevollmacht die Formulare der eigenen Hausbank zu nutzen.
Der Vorteil einer Vorsorgevollmacht gegenüber einer gesetzlichen Betreuung liegt vor allem darin, dass ein Bevollmächtigter sofort handlungsfähig ist, wenn der Vollmachtgeber dies selber nicht mehr ist. Die Bestellung einer gesetzlichen Betreuung kann möglicherweise länger dauern. Normalerweise kann ein*e gesetzliche*r Betreuer*in nur bestellt werden, wenn der zu Betreuende damit einverstanden ist. Dazu muss dem Richter dringend eine fachärztliche Stellungnahme vorliegen, dass eine solche Betreuung (a) aus medizinischer Sicht notwendig ist und (b), dem Betreuten durch diese Betreuung keine Nachteile entstehen können.
Außerdem kann ich durch meine Vollmacht selber bestimmen, wer mich vertreten darf. Ein Gericht könnte zum Beispiel entscheiden, dass eben nicht ein Elternteil zum gesetzlichen Betreuer bestellt wird, wenn es bestimmte Gründe dafür sieht.
Letzteres setzt voraus, dass ich jemanden bevollmächtige, dem ich auch wirklich 100%ig vertraue, denn mit solch einer Vollmacht könnte jemand auch Missbrauch treiben und sich möglicherweise persönlich bereichern.
Dies könnte man durchaus als Nachteil sehen. Ein (ehrenamtlicher) gesetzlicher Betreuer wird regelmäßig vom Gericht geprüft und muss Rechenschaft über sein Handeln ablegen. Dies kann in Form von Jahresberichten sein, in Form einer vollständigen Rechnungslegung, oder dadurch, dass er eine bestimmte seiner Entscheidungen rechtfertigen muss.
Nichts desto trotz bedeuten sowohl die Vertretung eines Menschen durch eine Vorsorgevollmacht, als auch die durch eine vom Gericht bestellte Betreuung stets eine große Verantwortung. Das Gesetz schreibt vor, dass man immer den ausgesprochenen, oder wenn dies nicht möglich ist, den vermuteten Willen des Menschen zu berücksichtigen hat, den man da vertritt.
Eine Vorsorgevollmacht ist auch nicht dasselbe, wie eine Patientenverfügung. In einer Patientenverfügung äußert man seinen Willen bezüglich der eigenen medizinischen Behandlung für den Fall, dass man sterbenskrank ist und sich dann nicht mehr äußern kann. Sowohl der Bevollmächtigte, als auch der gesetzliche Betreuer müssen in ihren Handlungen den in der Patientenverfügung geäußerten Willen respektieren.
Eine Vorsorgevollmacht muss heutzutage nicht mehr notariell beglaubigt werden:
(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll. (2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht. (BGB § 167 Erteilung der Vollmacht)
Manche Berater, vor allem Notare, empfehlen jedoch eine solche Beglaubigung, um die Beweiskraft dieser Vollmacht zu erhöhen. Auf jeden Fall sollte man eine Beglaubigung in Betracht ziehen, wenn potentiell Eigentumsgeschäfte zur vertretenden Handlung gehören können, da Grundbuchämter und auch Handelsregister nur beglaubigte Vollmachten anerkennen.
Mittlerweile dürfen auch die sogenannten Betreuungsbehörden, oft Teil der Kommunal-, oder Kreisverwaltung, solche Vorsorgevollmachten beglaubigen. Vor allem sind diese immer günstiger als die Notare.
(2) Die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde ist befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen öffentlich zu beglaubigen. Dies gilt nicht für Unterschriften oder Handzeichen ohne dazugehörigen Text. Die Zuständigkeit der Notare, anderer Personen oder sonstiger Stellen für öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen bleibt unberührt. (BtBG, § 6)
Hat man einmal eine solche Vorsorgevollmacht erstellt, verbleibt diese im Besitz des Vollmachtgebers. Der Vollmachtnehmer sollte selbstverständlich wissen, wo sich das Dokument im Haushalt befindet, damit er sich dieses holen kann, wenn der Vertretungsfall eintritt. Darüber hinaus empfehlen wir auch, am selben Ort andere wichtige Dokumente aufzubewahren, die für den Vertreter hilfreich sein könnten: Kranken- und Rentenversicherungsnummer, Girokontonummer, Kopie des aktuellen Personalausweises, Patientenverfügung (falls vorhanden), evtl. Einkommensbescheide und generell aktuell und potentiell wichtiger Schriftverkehr.
Dann gibt es noch in Deutschland ein Zentrales Vorsorgeregister. Dort kann man gegen eine Gebühr die Informationen zur eigenen Vorsorgevollmacht, sowie die Kontaktdaten des Vollmachtnehmers hinterlegen. Die Amtsgerichte prüfen auf Anfrage, ob dort eine Vorsorgevollmacht hinterlegt ist, bevor es zu einer gesetzlichen Betreuung kommt.
Beratung
Anerkannte Betreuungsvereine dürfen seit dem 1. Juli 2005 Personen beraten, die eine Vorsorgevollmacht errichten wollen (§ 1908f Abs. 4 BGB https://www.bundesanzeiger-verlag.de/betreuung/wiki/Vorsorgevollmacht_-_vertiefte_Infos)
Im Rahmen meiner Tätigkeit für den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e.V. bin ich auch für die sogenannte Querschnittsarbeit zuständig, zu der auch die Beratungen zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung gehören.